
Themenstarter

|
Darum habe ich geschrieben" oder lass es"!
Also den Scheinwerfer mit Streuscheibe montieren und fertig.
Außerdem, das ding mit der Betriebserlaubnis ist schon etwas komplizierter und bei dem was manche so an der Goldwing spazieren fahren ist sicher bei etlichen die Betriebserlaubnis in Gefahr.
Bei dem Scheinwerfer würde ich übrigens keine Gefährdung sehen da dieser in USA offiziell zugelassen ist.
Erlöschen der Betriebserlaubnis
Das „Erlöschen der Betriebserlaubnis“ (im Weiteren „BE“ genannt) ist immer wieder Schwerpunktthema im Technikforum. Zumeist steht das Erlöschen der BE in Verbindung mit Fragen, bei denen es um Änderungen an Fahrzeugen und insbesondere um Leistungssteigerungen von Mofas oder Kleinkrafträdern geht.
Im Folgenden werde ich versuchen das Wichtigste hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen zusammenzutragen, um zumindest die allgemeinen Fragen beantworten zu können. Einzelfälle können und sollen natürlich auch weiterhin zur Diskussion gestellt werden.
Leider ist festzustellen, dass das zur Disposition stehende Thema auch mit dem Inkrafttreten der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) weiter aktuell bleibt. Der § 19 StVZO wird durch Artikel 2 der Verordnung zur Neuordnung des Rechts der Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften lediglich in Teilbereichen geändert. Ich werde hierzu nochmals ausführlich Stellung beziehen.
Natürlich darf auch hier der Hinweis nicht fehlen, dass dies keine rechtsverbindliche Ausarbeitung ist und ausschließlich die persönliche Rechtsauffassung des Verfassers widerspiegelt, die allerdings mit Gesetzestexten und Gerichtsentscheidungen unterlegt ist. Wer sich die einschlägigen Threads durchliest wird auch schnell feststellen, dass sich selbst Fachleute zu dieser Thematik nicht immer einig sind.
Das Erlöschen der BE ist in § 19 Abs. 2 und 3 StVZO geregelt und ist keinesfalls mit einer Betriebsuntersagung nach § 5 FZV zu verwechseln.
Zwar liegt hier ein Erlöschen der BE Kraft Gesetz vor, dennoch ist eine konkludente Anwendung des Verwaltungsrechts möglich. Verwaltungsrechtlich ist das Erlöschen der Betriebserlaubnis mit einer so genannten auflösenden Bedingung i. S. d. § 36 Abs. 2 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) gleichzusetzen, was aber hier nicht weiter zu vertiefen ist.
Wird auf ein Erlöschen der BE erkannt, dann liegt eine Ordnungswidrigkeit, ein Verstoß gegen § 3 FZV für zulassungspflichtige Fahrzeuge und gegen § 4 FZV für betriebserlaubnispflichtige Fahrzeuge vor. Als Rechtsfolgen sind hier ein Bußgeld von 50 € und 3 Pkt. vorgesehen. Diese Rechtsauffassung wird derzeit allerdings nicht von allen Bundesländern getragen, so dass es zu unterschiedlichen Ahndungen kommt, worauf ich hier näher eingehe.
Mit Einführung der FZV und Novellierung des Bußgeldkataloges handelt es sich nur noch um einen B-Verstoß, was allerdings nur auf einen schwerwiegenden redaktionellen Fehler zurückzuführen sein kann und dringend einer Überarbeitung bedarf. Bis zum 28.02.2007 handelte es sich um einen A-Verstoß, was eine Verlängerung der Probezeit bei Führerscheinneulingen nach sich zog. Insofern ist die rechtliche Einstufung ob nur eine simple Unvorschriftsmäßigkeit oder ein Erlöschen der BE vorliegt, schon von erheblicher Bedeutung für den Betroffenen.
Die Tathandlung und die tatbestandlichen Voraussetzungen
Ein Erlöschen der BE ist zunächst einmal an eine bestimmte Tathandlung, nämlich das „Ändern“ gebunden.
Änderungen können nur durch:
- Veränderungen an Bauteilen
- Austausch und / oder Hinzufügen von Bauteilen, wobei für die ausgetauschten Bauteile keine Bauartgenehmigung vorliegt oder
- Entfernen von Bauteilen
vorgenommen werden. Die Änderung setzt voraus, dass diese bewusst willentlich und damit vorsätzlich herbeigeführt wird. Wenn also jemand den Auspuff verliert, liegt keine Änderung i. S. d. § 19 Abs. 2 StVZO vor und damit kein Erlöschen der BE. Anders, wenn beispielsweise der Mittelschalldämpfer entfernt wird, um einen „kernigeren“ Sound zu erreichen.
Durch die Änderung müssen jedoch eine oder mehrere weitere tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt werden. Entweder muss
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert werden,
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten sein oder
3. das Abgas- und Geräuschverhalten verschlechtert werden.
Eine Kombination der einzelnen Punkte ist durchaus möglich.
Zu 1.)
Die wohl häufigste Variante der Änderung der Fahrzeugart, ist die Leistungssteigerung von Mofas und Kleinkrafträder, durch Manipulationen an der Variomatik, Ausbau von Drosseln oder anderen Eingriffen in die Fahrzeugtechnik.
Nach geltender Rechtsprechung wird grundsätzlich ein Geschwindigkeitszuschlag von 10 % auf die bauart-bedingte Höchstgeschwindigkeit (bbH) gewährt. Wird diese Geschwindigkeit durch oben genannte Änderungen überschritten, kann sich u. u. die Fahrzeugart ändern.
Neben dem Erlöschen der BE hat dies auch noch fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen, da sowohl Kleinkrafträder als Krafträder fahrerlaubnispflichtig sind. Liegt eine gültige Fahrerlaubnis nicht vor, dann handelt es sich um ein Fahren ohne Fahrerlaubnis i. S. d. § 21 StVG.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Entscheidung des OLG Karlsruhe, Beschluss vom 25.11.2002- Aktenzeichen 1 Ss 73/02. Hiernach liegt auch dann ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vor, wenn ein Leichtkraftrad auch ohne Vornahme technischer Veränderungen regelmäßig eine wesentlich höhere Geschwindigkeit als die bauartmäßig zulässige erreichen kann.
Bei einem Schadensfall kann die Versicherung den Versicherungsnehmer bis zu 5000 € in Regress nehmen. Im Innenverhältnis, also der Kaskoversicherung (sofern eine solche abgeschlossen wurde), ist der Versicherer von der Leistungspflicht befreit.
Achtung! Durch Leistungssteigerung herbeigeführte Änderung eines Mofa (FmH 25) in ein Kleinkraftrad (bis 45 km/h) ist keine Änderung der Fahrzeugart!
Eine Veränderung der Fahrzeugart mit der o. g. Rechtsfolge wird zumeist auch bei Leistungssteigerungen an Mofa (FmH 25) unterstellt. Eine solche Anzeige ist jedoch rechtsfehlerhaft, wenn sich diese ausschließlich auf die Veränderung der Fahrzeugart begründet, ohne dass die ermittelte Endgeschwindigkeit 45 km/h übersteigt.
Dies ergibt sich daraus, dass die Fahrzeugarten in der Richtlinie 70/156/EWG (dort im Anhang II) und in der Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. März 2002 über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 92/61/EWG des Rates (dort in Art. 1 Abs.2) vorgegeben sind.
Verdeutlicht wird das ebenfalls in der Verbindlichen Arbeitsanweisung der Technischen Leitungen aller amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen und Technischen Prüfstellen vom 18.10.2001 in der aktualisierten Fassung vom 17.12.2003.
Gem. Punkt 2.5 Änderungsabnahmen zur Änderung der Fahrzeugart, gelten als typische Beispiele für derartige Änderungen:
• Pkw in Lkw
• Lkw in Sonder-Kfz
• Pkw in Sonder-Kfz
• Lkw in Selbstfahrende Arbeitsmaschine
• Lkw in Zugmaschine
Zu beachten ist, dass Änderungen innerhalb einer Fahrzeuggruppe oder –klasse, ohne eine wesentliche Änderung der Zweckbestimmung und/oder der Aufbauart, wie z. B.:
• Kraftrad ohne Leistungsbeschränkung in Kraftrad mit Leistungsbeschränkung
• Kleinkraftrad in Mofa und umgekehrt,
nicht als Änderung der Fahrzeugart verstanden werden. Dies ist nur eine logische Schlussfolgerung, da die Rili 2002/24/EG, als auch die Verordnung über die EG- Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge (Krad-EG-TypV), eine solche Differenzierung gar nicht vorsieht. Es wird in Art. 1 Abs. 2 (Rili 2002/24/EG) bzw. § 1 Abs. 2 (Krad-EG-TypV) lediglich zwischen Kleinkrafträder und Krafträder unterschieden.
Auszug Krad-EG-TypV:
Zitat
§ 1 Abs. 2
Die Fahrzeuge nach Absatz 1 Nr. 1 werden in nachstehende Klassen unterteilt:
1. „Kleinkrafträder“ sind zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und folgenden Eigenschaften:
a) zweirädrige Kleinkrafträder (Klasse L1e):
Hubraum von bis zu 50 cm3 im Falle von Verbrennungsmotoren oder maximale Nenndauerleistung von bis zu 4 kW im Falle von Elektromotoren;
b) dreirädrige Kleinkrafträder (Klasse L2e):
Hubraum von bis zu 50 cm3 im Falle von Fremdzündungsmotoren oder maximale Nutzleistung von bis zu 4 kW im Falle anderer Verbrennungsmotoren oder maximale Nenndauerleistung von bis zu 4 kW im Falle von Elektromotoren;
2. „Krafträder“ sind zweirädrige Kraftfahrzeuge ohne Beiwagen (Klasse L3e) oder mit Beiwagen (Klasse L4e) mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3 im Falle von Verbrennungsmotoren oder einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h;
Das bedeutet, dass ein Erlöschen der BE nur dann zum Tragen käme, wenn durch die Leistungssteigerung das Mofa die Baumerkmale eines Kraftrades aufweisen würde, also mehr als 45 km/h erbringt oder eine abstrakte Gefahr zu begründen wäre. Letzteres käme z. B. in Betracht, wenn es sich tatsächlich um ein FmH 25 handelt, das ausschließlich für diesen Geschwindigkeitsbereich gebaut ist und insbesondere das Fahrwerk, die Lenkung und die Bremsanlage für eine höhere Geschwindigkeit nicht ausgelegt sind, was allerdings nur in Ausnahmefällen zutreffen dürfte.
Fazit zu 1.)
Insbesondere bei Anzeigen bezüglich der Leistungssteigerung von Mofas (FmH 25) ist darauf zu achten, dass durch die Leistungssteigerung die bbH mehr als 45 km/h betragen muss, damit tatsächlich eine Änderung der Fahrzeugart vorliegt. Ist dies nicht der Fall, dann bleibt es zulassungsrechtlich bei einer geringfügigen Ordnungswidrigkeit, da ein Fahrzeug geführt bzw. in Betrieb genommen wurde, das nicht den Vorschriften entspricht, d. h., die Daten in der Betriebserlaubnis nicht mit den tatsächlichen Daten übereinstimmen. Dass hier auch noch fahrerlaubnisrechtliche Tatbestände zu prüfen sind, dürfte selbstverständlich sein.
Über die zuständige Verwaltungsbehörde kann gem. § 17 Abs. 3 StVZO (neu § 5 FZV) jedoch eine Betriebsuntersagung ausgesprochen werden.
Zu 2.)
Die tatbestandliche Voraussetzung des § 19 Abs. 2 Nr. 2 StVZO bedarf unzweifelhaft umfangreicher Erläuterungen, denn hier scheiden sich im wahrsten Sinne des Wortes die Geister. Daher noch mal der Hinweis, diese Ausarbeitung spiegelt ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und ist daher nicht rechtsverbindlich.
Um das Thema abschließend zu analysieren, bedarf es eines Rückblicks auf die alte Fassung (a. F.) des § 19 StVZO, der bis 31.12.1993 galt, da doch hin und wieder festzustellen ist, dass bei der Bewertung, ob die BE erloschen ist oder nicht, auf diese Fassung des § 19 zurückgegriffen wird.
- Erlöschen der BE bis 31.12.1993
Hiernach konnte nach § 19 Abs. 2 StVZO (a. F.) die BE erlöschen, wenn ein Fahrzeugteil verändert wurde, dessen Beschaffenheit vorgeschrieben war oder dessen Betrieb eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verursachen kann. Diese Formulierung bedeutete, dass zwei Tatalternativen möglich waren.
1. die Veränderung eines Fahrzeugteils, dessen Beschaffenheit vorgeschrieben ist (siehe § 22 a StVZO) und
2. die Veränderung eines Fahrzeugteils, dessen Beschaffenheit zwar nicht vorgeschrieben, aber durch dessen Veränderung eine Gefährdung zu erwarten ist.
Eine Veränderung i. S. d. Nr. 1 hatte also zur Folge, dass die BE erlöschen konnte, ohne dass eine abstrakte Gefährdung zu begründen war.
Diese Regelung wurde mit Recht als überzogen angesehen und mit Wirkung vom 01.01.1994 geändert.
- Erlöschen der BE ab 01.01.1994
Mit der Neufassung des § 19 Abs. 2 StVZO erlischt die BE nunmehr nur dann, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
3. das Abgas- und Geräuschverhalten verschlechtert wird.
Warum die Änderung vorgenommen wurde, ist der amtlichen Begründung zur Änderungsverordnung vom 16.12.1993 (VkBl. 94 149) zu entnehmen (Auszug):
Zitat
„Zu Abs. 2: …Die Betriebserlaubnis soll weiterhin erlöschen, wenn eine Gefährdung nach solchen Änderungen zu erwarten ist. Bislang war Ursache für das Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 (alt) entweder die Veränderung von Teilen, deren Beschaffenheit vorgeschrieben ist, oder die Veränderung von Teilen, deren Betrieb eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verursachen kann. Es scheint bedenklich – auch unter den rechtlichen Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit der Mittel -, eine so einschneidende Rechtsfolge wie das Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug schon dann eintreten zu lassen, wenn durch eine Änderung lediglich Beschaffenheitsvorschriften der StVZO berührt werden, ohne daß gleichzeitig auch eine Gefährdung anderer (also eine Gefährdung der Verkehrssicherheit) zu erwarten ist. Die bloße Möglichkeit der Gefährdung ist zu weitgehend, die Gefährdung muß schon etwas konkreter zu erwarten sein …
Im Sinne einer größeren Konkretisierung wurde auf die Gefährdung von Verkehrsteilnehmern hingewiesen (Fahrzeugführer, Fahrzeuginsassen, andere Verkehrsteilnehmer), da sich sowohl die EU als auch z. B. § 30 (Beschaffenheit der Fahrzeuge) in erster Linie auf den Schutz von Personen orientieren.“
Bereits daraus ergibt sich nunmehr, dass die BE nach § 19 Abs. 2 StVZO nur dann erlöschen kann, wenn tatsächliche Anhaltspunkte auf die Möglichkeit einer Gefährdung hinweisen. Bei der Beurteilung, ob eine Gefährdung anderer zu erwarten ist, sollte immer berücksichtigt werden, dass zum normalen Fahrbetrieb auch Ausweichmanöver, Gefahrenbremsungen und schlechte Wegstrecken gehören. In jedem Fall bleibt es eine Einzelfallentscheidung, die der richterlichen Nachprüfung unterliegt. Wenn das Gericht zu der Auffassung gelangt, dass ein Erlöschen der BE vorliegt, dann muss im Urteil explizit begründet werden, worin die Gefährdung bestand.
Der Begriff der Gefährdung wird in einem eigenen FAQ erläutert.
Das OLG Düsseldorf entschied im Jahre 1996 beispielsweise zur Frage des Anbringens eines Lenkradknaufs, was nach der a. F. des § 19 StVZO zum Erlöschen der BE führte, dass die alleinige Feststellung der nachträglichen Anbringung eines Lenkradknaufs das Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nicht belegt und der Tatrichter zusätzlich Feststellungen dazu treffen muss, ob durch die Anbringung eines Lenkradknaufs eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist. Dass es sich hierbei nur um eine abstrakte Gefährdung handeln kann, sei selbstverständlich.
In der Begründung zum Beschluss vom 12.1.1996, Az.: 5 Ss (OWi) 457/95 - (OWi) 2/96 I, wurde u. a. ausgeführt:
Zitat
„Die Voraussetzungen des hier für das Erlöschen der Betriebserlaubnis allein in Betracht kommenden § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 StVZO sind nach den Feststellungen nicht belegt. Ihnen ist nicht zu entnehmen, daß durch die nachträgliche Anbringung des Lenkradknaufs eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist. Allein die bloße Möglichkeit der Gefährdung reicht insoweit nicht aus; erforderlich ist ein gewisses Maß an Wahrscheinlichkeit, das sowohl durch den unsachgemäßen Anbau eines an sich ungefährlichen Fahrzeugteils als auch durch den Betrieb eines sachgerecht angebauten, aber gefährlichen Teils begründet werden kann (vgl. amtliche Begründung zur Neufassung von § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 StVZO in VkBl. 1994 149, 150; Jagusch/Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 33. Aufl. Rdn. 8 zu § 19 StVZO sowie OLG Köln bei Janiszewski in NStZ 1995, 587 ). Da das Urteil in dieser Hinsicht jegliche Feststellungen vermissen läßt, vermag der Senat nicht davon auszugehen, daß durch die Anbringung des Lenkradknaufs bzw. durch die Art und Weise seiner Anbringung beim Betrieb des Fahrzeuges eine Gefährdung anderer zu erwarten ist.
An dieser bereits der Senatsentscheidung vom 25. Juli 1995 in NZV 1996, 40 zugrunde liegenden Beurteilung hält der Senat trotz der von Kreutel/Schmitt in der ablehnenden Anmerkung zu dieser Entscheidung (NZV 1996, 41 f) vorgebrachten Einwände fest. Auch das vom OLG Celle a.a.O. in seiner Entscheidung mitgeteilte Gutachten des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt nicht die nunmehr in § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 StVZO geforderte Gefährdungserwartung, sondern lediglich die mit dem Vorhandensein eines Lenkradknaufs beim Betrieb des Fahrzeuges verbundenen Möglichkeiten einer Gefährdung des Fahrzeugführers und anderer Verkehrsteilnehmer auf. Die angeführten theoretischen Möglichkeiten erlauben indes entgegen Kreutel/Schmitt a.a.O. noch nicht den Schluß darauf, daß insoweit tatsächlich eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist. In dem "Beispielkatalog" des Bundesministers für Verkehr (VBl. 1994, 159 ff), der zwar nicht den Charakter einer Rechtsverordnung hat und weder verbindlich noch erschöpfend ist, jedoch eine der einheitlichen Rechtsanwendung förderliche Auslegungshilfe darstellt (BGHSt 32, 16, 18), ist der ausdrücklich angeführte Lenkradknauf nicht in der Spalte "Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt" aufgeführt. Daß dort lediglich bemerkt wird, daß der Anbau eines Lenkradknaufs grundsätzlich unzulässig und nur zulässig ist, wenn er in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs genehmigt bzw. als Auflage für Behinderte vorgeschrieben ist, rechtfertigt entgegen der Annahme von Kreutel/Schmitt a.a.O. noch nicht die in § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 StVZO geforderte Gefährdungserwartung. Ausweislich der amtlichen Begründung a.a.O. ist der Verordnungsgeber - auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit der Mittel - davon ausgegangen, daß es bedenklich erscheint, "eine so einschneidende Rechtsfolge wie das Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug schon dann eintreten zu lassen, wenn durch eine Änderung lediglich Beschaffenheitsvorschriften der StVZO berührt werden, ohne daß gleichzeitig eine Gefährdung anderer (also eine Gefährdung der Verkehrssicherheit) zu erwarten ist". Solange keine gesicherten Erkenntnisse über das bei realistischer Betrachtungsweise anzunehmende Gefahrenpotential vorliegen, muß deshalb im Einzelfall - ggf. mit Hilfe eines Sachverständigen (vgl. OLG Köln a.a.O.) - geprüft werden, ob wegen des Vorhandenseins eines Lenkradknaufs beim Betrieb des Fahrzeuges Gefahren für Verkehrsteilnehmer zu erwarten sind.“
Fazit:
Ein Erlöschen der BE i. S. d. § 19 Abs. 2 Nr. 2 StVZO ist somit nur möglich, wenn durch eine Änderung eine abstrakte Gefahrenlage begründet ist. Selbst wenn ein Bauteil, das der Bauartgenehmigung unterliegt (§ 22 a StVZO) durch ein nicht genehmigtes Bauteil ersetzt wird, lässt sich daraus nicht grundsätzlich eine abstrakte Gefahr herleiten. Vielmehr ist eine solche am konkreten Einzelfall festzumachen und sowohl in der Anzeige als auch in einem eventuell erwirkten Urteil nachprüfungsfähig festzuhalten.
Sollte nicht auf ein Erlöschen der BE erkannt werden, dann liegt dennoch eine Unvorschriftsmäßigkeit vor, die mit 25 € zu ahnden ist. Der Mangel muss selbstverständlich beseitigt werden. Befolgt der Betroffene die Anordnung nicht, so kann die Verwaltungsbehörde den Betrieb des Fahrzeugs nach § 17 StVZO untersagen.
Zu 3.)
Eine weitere Tatalternative ist die Verschlechterung des Abgas- und Geräuschverhaltens. Dieses kann durch entsprechende Abgas- und Geräuschmessungen nachgewiesen werden. Grundsätzlich wird jedoch von einer Verschlechterung ausgegangen, wenn Bauteile verwendet werden, die nicht bauartgemehmigt sind. Auch hier ist regelmäßig mit Sicherstellungen zur Beweissicherung zu rechnen.
Ausführungen zu § 19 Abs. 3 StVZO
Bis hierhin ist das Erlöschen der BE für den überwiegenden Teil der Leser sicherlich noch halbwegs nachvollziehbar. Wenn der Gesetz- und Verordnungsgeber nur nicht den unsäglichen Abs. 3 eingefügt hätte. Wer den Absatz ließt, kommt eigentlich nicht umhin, sich entweder an die einschlägigen Kommentierungen zu halten oder aber eine eigene Interpretation zu entwickeln. Im Folgenden werde ich meine kontroverse Rechtsmeinung darlegen und natürlich zur Diskussion stellen. Denn auch ich möchte mir nicht anmaßen, der Weisheit letzen Schluss entdeckt zu haben. Sollte es Diskussionsbedarf geben, dann bitte ich einen entsprechenden Thread zu öffnen.
Der gesamte Abs. 3 steht nach meinem Dafürhalten im Widerspruch zum Absatz 2 und der amtlichen Begründung zur Novellierung des § 19 im Jahre 1993/94.
Der amtlichen Begründung ist u. a. zu entnehmen:
Zitat
"Es scheint bedenklich – auch unter den rechtlichen Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit der Mittel -, eine so einschneidende Rechtsfolge wie das Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug schon dann eintreten zu lassen, wenn durch eine Änderung lediglich Beschaffenheitsvorschriften der StVZO berührt werden, ohne daß gleichzeitig auch eine Gefährdung anderer (also eine Gefährdung der Verkehrssicherheit) zu erwarten ist. Die bloße Möglichkeit der Gefährdung ist zu weitgehend, die Gefährdung muß schon etwas konkreter zu erwarten sein …"
Diesem Wortlaut ist eine große Bedeutung beizumessen, da sich hieraus die Intension des Gesetz- und Verordnungsgebers erkennen lässt, die zur Änderung des § 19 StVZO geführt hat. Darüber hinaus verdeutlicht die amtliche Begründung auch den Sinngehalt des § 19, nämlich unter welchen Bedingungen eine erteilte Betriebserlaubnis erlöschen kann.
Es ist nach dem Wortlaut der amtlichen Begründung i. V. m. dem Verordnungstext des § 19 Abs. 2, dem Gesetz- und Verordnungsgeber zu unterstellen, dass er mit der Novellierung erreichen wollte, dass eine Betriebserlaubnis nur dann erlöschen kann, wenn durch Änderungen
- die Fahrzeugart geändert wird
- das Abgas- und Geräuschverhalten verschlechtert wird
- oder durch Änderungen eine Gefährdung anderer zu erwarten ist,
wobei er ja explizit darauf hingewiesen hat, dass die Betriebserlaubnis nur dann erlöschen kann, wenn durch Änderungen, die die Beschaffenheitsvorschriften betreffen, auch eine Gefährdung der Verkehrssicherheit zu erwarten ist!!!
Nun wurde, aus für mich überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen, der Absatz 3 ebenfalls neu eingefügt.
Bereits der einleitende Satz steht im Widerspruch zum Absatz 2.
Zitat
„Abweichend von Absatz 2 Satz 2 erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs jedoch nicht, wenn …“
Es erfolgt die Benennung von Ausnahmen, bei denen entgegen den Bestimmungen des Abs. 2 die BE nicht erlischt, worauf hier aber nicht weiter einzugehen ist.
Würde der Abs. 3 nun als eigenständige Regelung angesehen werden (wie es zumeist üblich ist), die sich nicht systematisch in den § 19 einfügt, würde das bedeuten, ...
- bitte sorgfältig lesen -
... dass selbst wenn eine Gefährdung der Verkehrssicherheit zu erwarten ist, die Voraussetzungen des Absatzes 3 aber erfüllt werden, die Betriebserlaubnis nicht erlischt. Dann wird also ganz legal, also staatlich legitimiert, ein Fahrzeug geführt, von dem eine erhöhte Betriebsgefahr ausgeht (siehe hierzu § 30 Abs. 1 Nr. 1 StVZO). Andererseits erlischt die BE selbst dann, wenn nur eine Formalie nicht eingehalten wird, eine Gefährdung aber nicht zu begründen ist.
Nun kommt auch noch die unglückliche Regelung aus Abs. 3 Satz 2 (letzter Satz) hinzu.
Zitat
„Werden bei Teilen nach Nummer 1 oder 2 in der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmigung oder der Genehmigung aufgeführte Einschränkungen oder Einbauanweisungen nicht eingehalten, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.“
Hier wird nunmehr ein Erlöschen der BE unterstellt, wenn die Einschränkungen oder Einbauanweisungen nicht eingehalten werden. Das bedeutet konsequenter Weise, dass keine Gefährdung nachgewiesen werden muss.
Damit hätten wir aber wieder die gleiche Gesetzeslage, wie vor der Novellierung.
Das kann der Gesetz- und Verordnungsgeber nicht gewollt haben!!!
Nun ist es aber leider so, dass in den einschlägigen Kommentaren genau diese Rechtsmeinung vertreten wird. Sowohl der Kirschbaum StVZO Kommentar wie auch der Hentschel stützen sich darauf, dass der § 19 Abs. 3 unabhängig von Abs. 2 zu werten ist. Dabei wird auf einen Aufsatz von Werner Kullik Polizeidirektor a. D. (VD 03 147) verwiesen.
Zu diesem Aufsatz ist anzumerken, dass der Autor den § 19 vom reinen Aufbau und in Verbindung mit dem Verwaltungsrecht analysiert hat. Aus urheberrechtlichen Gründen darf ich diesen hier leider nicht einfügen. Wer aber interessiert ist, kann diesen gegen eine kleine Gebühr unter diesem Link abrufen.
Insbesondere die Ausführungen zum letzten Satz sind überzeugend, da im Abs. 3 Satz 2 tatsächlich eine auflösende Bedingung i. S. d. § 36 Abs. 2 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zu unterstellen ist.
Das würde nach dieser Auslegung tatsächlich bedeuten, dass die BE unabhängig von Abs. 2 auch dann erlischt, wenn zwar keine Gefährdung zu erwarten ist, aber die Einbauanweisungen oder Einschränkungen nicht beachtet wurden.
Insofern befinden wir uns in einer Zwickmühle zwischen der reinen Formulierung des Verordnungstextes sowie dem vom Verordnungsgeber angedachten Regelungsgehalt und den sich daraus erwachsenden Interpretationsmöglichkeiten.
Ich für meinen Teil favorisiere natürlich, dass die BE nur erlöschen kann, wenn eine Gefährdung der Verkehrssicherheit zu erwarten ist, da nur das Sinn macht
|
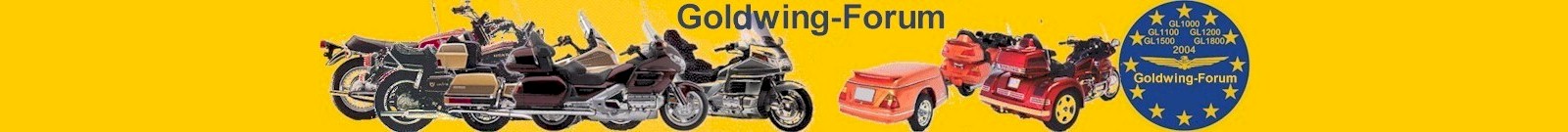

 25.02.16, 10:31:55
25.02.16, 10:31:55
 25.02.16, 12:31:25
25.02.16, 12:31:25
 25.02.16, 12:56:57
25.02.16, 12:56:57

 25.02.16, 13:50:36
25.02.16, 13:50:36
 25.02.16, 14:31:12
25.02.16, 14:31:12
 25.02.16, 14:43:18
25.02.16, 14:43:18

 25.02.16, 14:54:35
25.02.16, 14:54:35

 25.02.16, 15:06:32
25.02.16, 15:06:32
 25.02.16, 15:12:14
25.02.16, 15:12:14

 25.02.16, 15:44:53
25.02.16, 15:44:53
 25.02.16, 16:57:33
25.02.16, 16:57:33

 25.02.16, 16:57:57
25.02.16, 16:57:57
 25.02.16, 17:02:06
25.02.16, 17:02:06

 25.02.16, 17:27:16
25.02.16, 17:27:16
 25.02.16, 18:04:27
25.02.16, 18:04:27

 25.02.16, 18:07:30
25.02.16, 18:07:30
 25.02.16, 18:12:03
25.02.16, 18:12:03

 25.02.16, 18:44:46
25.02.16, 18:44:46
 25.02.16, 20:31:41
25.02.16, 20:31:41

 Umrüstung LED Leuchtmittel Hauptscheinwerfer - Beleuchtung
Umrüstung LED Leuchtmittel Hauptscheinwerfer - Beleuchtung
 von Marcus
von Marcus

 Gutachten Klarglascheinwerfer
Gutachten Klarglascheinwerfer
 von Sunshine
von Sunshine

 Umrüstung Hauptscheinwerfer - Beleuchtung
Umrüstung Hauptscheinwerfer - Beleuchtung
 von Seppel55
von Seppel55

 Mehr Licht möglich?
Mehr Licht möglich?
 von erich6856
von erich6856

 H7 Led Birnen bald legal
H7 Led Birnen bald legal
 von Christian SU
von Christian SU